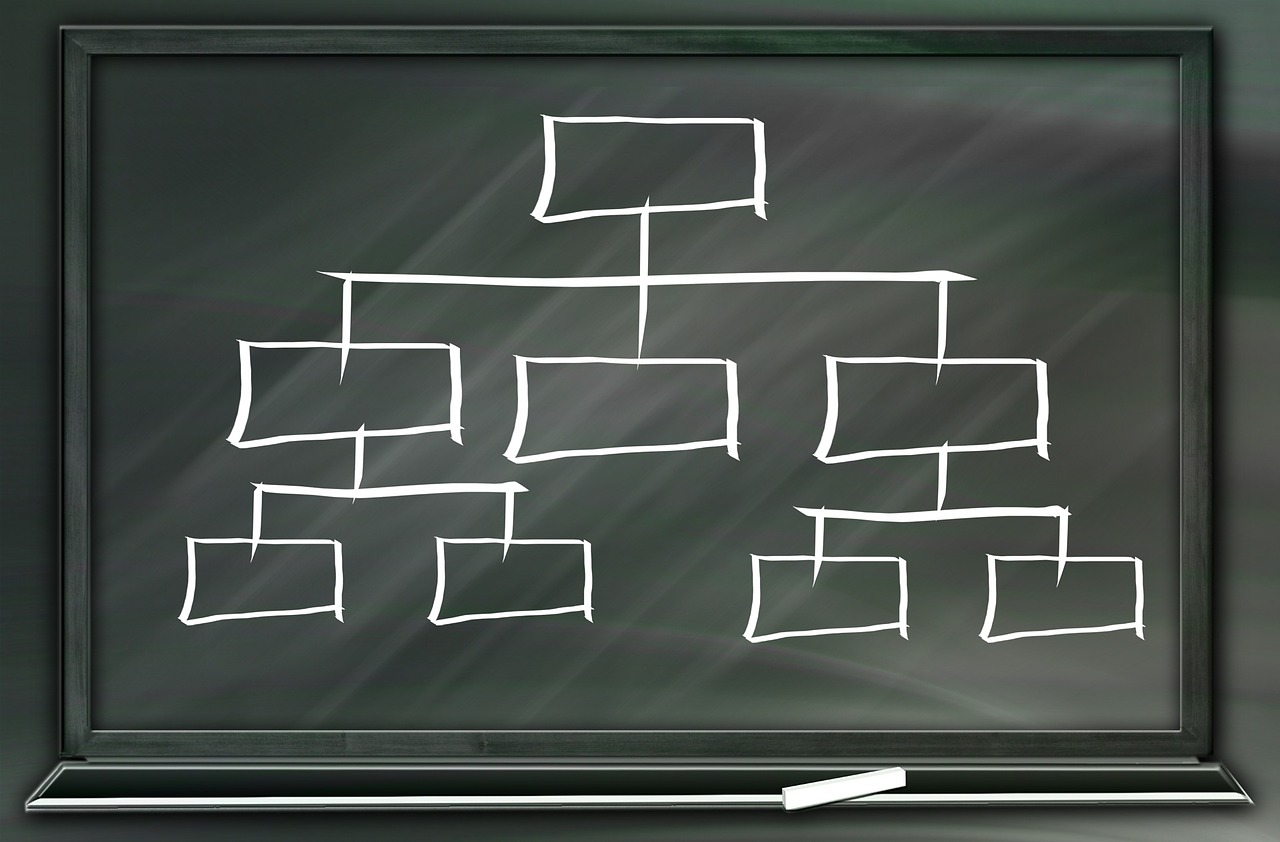[Here’s an English version of this article on Medium.]
Bereits die Überschrift wird dazu führen, dass einige Männer* auf die Barrikaden gehen. „Ich muss gar nichts“ ist in diesem Zusammenhang eine zu erwartende Reaktion, die mir selbst nicht ganz fremd ist. Doch im Kontext Patriarchat – Privileg – System ist es unerlässlich, dass ich bestimmte Befindlichkeiten zumindest temporär ablegen kann, um einen Lernerfolg möglich zu machen. Und einen solchen brauchen wir. Wir benötigen ein Verständnis über einige der Zusammenhänge, die uns zwar unmittelbar betreffen, deren negative Auswirkungen jedoch ganz andere Gruppen belasten oder sogar bedrohen. Beginnen wir mit dem Thema Privileg.
Privilegien sind strukturell eingebettete Vorteile.
Ich bin ein cis Mann. Das bedeutet, ich identifiziere mich mit dem sozialen Geschlecht, das mir seit meiner Geburt aufgrund meiner körperlichen Merkmale zugeschrieben wird. Die lateinische Vorsilbe cis bedeutet „diesseits“, im Gegensatz zu trans, das für „jenseits“ steht. Bereits an dieser Stelle könnte man sich mit einem Blick auf Strukturen und Systeme fragen, welche gedachte Linie der Normativität hier gezogen wird und wer etwa die Deutungshoheit über diese Linie besitzt.
Aber ich bin noch mehr: Ich bin weiß, habe keine Behinderung, bin mit 1,90m recht groß, bin heterosexuell und bin in einer sozial mehr oder weniger privilegierten Familie in Deutschland geboren und aufgewachsen. Ich bin aufgrund meiner unveränderlichen Identitätsmerkmale also de facto hyperprivilegiert. Und dies bedeutet wiederum, dass ich aufgrund verschiedener systemischer Rahmenbedingungen Rückenwind erlebe. Ich profitiere innerhalb von Kapitalismus, Rassismus oder Patriarchat, ohne dass ich etwas dafür getan hätte oder tun müsste. Systeme sind jedoch komplex, so dass sich ein etwas genauerer Blick darauf lohnt.
In patriarchalen Systemen wirken doppelte Hierarchien.
Als Mann laufe ich tagtäglich Gefahr, manipuliert zu werden. Und zwar von einem System, das mir einerseits vorgaukelt, ich sei als Mann den Frauen überlegen, während mich dasselbe System permanent dazu anhält, mich auch gegen andere Männer* zu behaupten. Man nennt dieses systemimmanente Phänomen „doppelte Hierarchie“. Das System hat auch einen Namen, es ist das Patriarchat.
Aber es kommt noch schlimmer. Denn sobald Männer* mitbekommen, dass Mitglieder bestimmter Gruppen – Frauen etwa – Unterstützung erhalten, damit systemische Ungerechtigkeiten ausgeglichen werden können, dann bricht sich die männliche Frustration Bahn und es wird vehement oder passiv-aggressiv auf derlei Bestreben reagiert. Ein Beispiel ist die Einführung einer Frauenquote. Man(n) fühlt sich unmittelbar ungerecht behandelt, denn für Menschen mit Privilegien fühlt sich Gerechtigkeit nun einmal wie Benachteiligung an1. Der Schweizer Männerforscher Markus Theunert formulierte es in einem Interview wie folgt: „Das Kernprivileg der Männer ist die Illusion, nicht privilegiert zu sein.“2 Wer bei diesen Sätzen bereits einen Knoten im Hirn spürt: Das ist Absicht. Was uns unmittelbar zum nächsten Punkt bringt.
Der Zweck eines Systems ist, was das System tut.
Der Satz stammt von dem britischen Kybernetiker Stafford Beer. Er gibt damit einen Hinweis darauf, dass sich der Blick auf die Wirkweisen von uns umgebenden Systemen nicht nur lohnt, sondern sogar unerlässlich ist. Wir alle müssen uns immer wieder Fragen stellen: Sind die Auswirkungen eines bestimmten Systems oder der von uns geschaffenen Strukturen tatsächlich noch die, die wir ursprünglich intendiert hatten? Haben sich im Laufe der Zeit unerwünschte und/oder nicht intendierte Auswirkungen ergeben, die ggf. längst nicht mehr hilfreich oder sogar kontraproduktiv oder gefährlich sind? Oder aber war die Grundintention des Systems genau dies: Menschen abzuwerten, um anderen Menschen einen Vorteil zu verschaffen? Rassistische Systeme wären etwa ein Beispiel für Letzteres.
Die Frage „Cui bono?“, also: „Wem nützt das?“, ist stets ein guter Ausgangspunkt für die Betrachtung von Systemen und Strukturen. Ijeoma Oluo schreibt in diesem Zusammenhang: „Um uns zu befreien, müssen wir jedes einzelne System, in dem wir uns befinden, in Frage stellen – auch die Systeme, von denen wir uns noch nicht trennen können.“3 Damit sind keine Verschwörungstheorien als Grundlage für fragiles Ausagieren gemeint gegen den Status Quo, sondern ganz im Gegenteil: Es braucht eine konstruktiv-kritische, demokratiezugewandte und wertschätzende Grundhaltung für die Transformation.
Der Blick auf systemische Rahmenbedingungen sollte dabei stets möglichst ganzheitlich und multiperspektivisch erfolgen. Wenn ich beispielsweise Strukturen und Prozesse in einer Organisation vor diesem Hintergrund betrachte, dann tue ich gut daran, auch einen Blick auf Kultur und Kommunikation, auf Verhalten und Fähigkeiten von Individuen, sowie auf Haltung und Mindset der beteiligten Personen zu richten; und vor allem: auf die Wechselwirkungen zwischen diesen Bereichen. Erst dann kann ich den Status Quo des Gesamtsystems und dessen Auswirkungen auf bestimmte Gruppen kompetent evaluieren. Zumal dann auch klarer wird, dass systemische Dysbalancen keine Grundlage für ganz bestimmte Opferrollen bieten, die nicht selten den Dialog erschweren oder gar verunmöglichen.
„Alter weißer cis-hetero Mann“ taugt nicht als individueller Vorwurf.
Die Diskussion über Privilegien führt häufig dazu, dass sich identitätspolitische Grabenkämpfe noch verschärfen. Nicht wenige weiße cis-hetero Männer empfinden die Zuschreibung „alter weißer Mann“ als Fundamentalkritik an ihrer Person. Doch wer bei der Erklärung von Privilegien vs. System aufgepasst hat, hat vielleicht bemerkt, dass aus einer privilegierten Identitätskonstruktion schon allein deshalb kein Vorwurf erwachsen kann, weil die betroffene Person für ihre Privilegien nichts getan hat. Somit liefe auch ein daran geknüpfter Vorwurf unmittelbar ins Leere. Es geht vielmehr um die Benennung einer Überrepräsentation einer bestimmten Gruppe als Beispiel für eine systemische Schieflage. Der Mann ist hier nicht als Individuum adressiert, sondern in seiner Rolle als Mitglied einer sozialen Gruppe.
Und dennoch gilt die daraus entstehende Entlastung nur für einen recht kurzen Zeitraum. Denn aus Privileg erwächst Verantwortung. Männer* haben überdurchschnittlich viel Macht, Geld und Einfluss. All dies gilt es für eine Veränderung von Systemen hin zu mehr Fairness und Gerechtigkeit in die Waagschale zu werfen. Bleibt eine derartige Verantwortungsübernahme aus, ist ein Vorwurf dann irgendwann doch gerechtfertigt. Zumal es unmittelbar eine weitere gedankliche Hürde zu nehmen gilt.
Ich kann bei bester Absicht ein Teil des Problems sein.
Die australische Soziologin Raewyn Connell prägte u. a. den Begriff einer „patriarchalen Dividende“. Sie beschrieb damit das Phänomen, wonach Männer* in patriarchalen Systemen ohne eigenes Zutun profitieren. Zwar bedeutet das nicht, dass alle Männer* im Patriarchat gleichermaßen Vorteile genießen (vgl. doppelte Hierarchie) oder dass Frauen nicht profitieren können (Spoiler alert: Sie können), dennoch beschreibt der Begriff recht anschaulich die Funktionsweise derartiger Systeme.
Es gibt aber auch eine Schattenseite. Denn Männer* werden einerseits zwar durch patriarchale Anreize besser gestellt, gleichzeitig aber auch anhand ihres theoretischen Gefahrenpotenzials pauschal beurteilt. Ein Mann stellt für eine weiblich gelesene Person (bzw. u. U. auch für andere, weniger privilegierte Männer*) mindestens eine theoretische Bedrohung dar.
Wechselt eine Frau also beispielsweise in einer dunklen Seitengasse die Straßenseite, sobald sie meiner gewahr wird, dann ist eine unmittelbare Reaktion nach dem Motto „Warum tut sie das, ich bin doch keiner dieser bösen Männer?!“ zwar nachvollziehbar, aber dennoch unangebracht: Sie muss schlicht davon ausgehen, dass ich eine potenzielle Bedrohung für sie bin. So perfide ist ein System, in dem der Femizid die Spitze eines ebenso entsetzlichen wie komplexen Eisbergs darstellt.
Wer sich lediglich verbal davon distanziert, indem er eine Linie zwischen sich und „den bösen Männern“ zieht, der verkennt nicht nur das Problem, sondern verweigert sich einer nötigen Reflexion über die eigene Rolle. Wenn ich hingegen die Perspektive annehmen kann, das ich – trotz bester Absicht – ein Teil des Problems innerhalb patriarchaler Strukturen sein könnte, dann ist dies ein wichtiger erster Schritt hin zu einer Lösung, an der ich tatsächlich auch beteiligt sein kann.
*Das Sternchen hinter „Männer“ soll dafür sensibilisieren, dass die binären Geschlechterkategorien recht eng und oft unflexibel sind. Es ist ein Hinweis darauf, dass die Geschlechtervielfalt ebenso groß ist wie ihre individuellen und kollektiven Zuschreibungen fluide sind.
Foto von Matthew Henry bei Unsplash
- Diese Aussage wird Romeo Bissuti, dem Psychologen und Leiter des Männergesundheitszentrums Wien, zugeschrieben. ↩︎
- Das Zitat stammt aus diesem Interview mit der NZZ: https://www.nzz.ch/nzz-am-sonntag/man-tut-so-als-waere-es-erstrebenswert-mann-zu-sein-ld.1737954 ↩︎
- Zitiert aus dem Vorwort zu: Tulshyan, Ruchika. Inclusion on Purpose. Cambridge, Mass., MIT Press. 2022. ↩︎